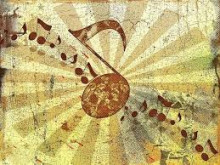
Der letzte integrale politische Salon im Juni war dem Thema „Musicosophia und Achtsamer Dialog“ gewidmet.
Musicosophia ist ein in Sankt Peter im Schwarzwald ansässiger Verein, der die Kunst des achtsamen Musikhörens unterrichtet. Die ganzheitliche Musicosophia-Methode des Hörens und Begreifens von Musik wurde von dem rumänischen Musikwissenschaftler George Balan speziell für musikalische Laien entwickelt. Sie baut auf den natürlichen musikalischen Anlagen des Menschen auf und arbeitet ohne Noten und weitgehend ohne musiktheoretische Begriffe. Über wiederholtes Hören ausgewählter Meisterwerke von der Gregorianik über Bach, Mozart, Beethoven bis hin zur Moderne wird vielmehr das konzentrierte Zuhören, die innere Anteilnahme und das Erkennen der musikalischen Motive und Themen geübt und geschult und der Aufbau eines Werkes erschlossen. Das Wesen der Musik wird schließlich mittels den Melodien folgenden Gebärden (Melorhythmie) verdichtet und verinnerlicht.

Den Impuls für diesen Salon am 19.06.2025 gab Carola Zenetti, langjährige Mitarbeiterin von Musicosophia, die sich zugleich intensiv mit dialogischen Methoden und gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, wie wir sie unter anderem im Kontext der integralen Politik einüben und praktizieren. So entstand der Wunsch, etwaige Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen diesen Ansätzen einmal praktisch zu erkunden.

Holger Heiten spricht im Blick auf den achtsamen Dialog von einer „Gemeinsamen Gegenwärtigkeit“. In einem solchen Dialog nehmen die Menschen eine Haltung von Respekt und wacher Offenheit den anderen gegenüber ein. Er ist gekennzeichnet durch Langsamkeit und zugewandtes Zuhören und das Hervorbringen von Gedanken und Sichtweisen, dem die Gruppenenergie zu Grunde liegt.
Zu einer ebensolchen Haltung lädt Musicosophia beim bewussten, schöpferischen Musikhören ein, der Musik und den anderen Teilnehmenden gegenüber. Was bringt uns die Musik aus der geistigen Sphäre mit, aus der die Komponist/innen sie geschöpft haben? Wie kann sie für unser Miteinander fruchtbar werden?

7 Teilnehmende waren bei diesem Salon-Experiment dabei und ließen sich von Carola in die Welt von Musicosophia einführen. Zwei von ihnen hielten ihre Eindrücke fest und beschreiben sie wie folgt:
Alles war eingebettet in den Wechsel von Stille, aktivem Zuhören und Austausch. In der Eingangsrunde wurde die erwartungsvolle Neugier aller Anwesenden deutlich.
Wir hörten 2x ein uns allen unbekanntes Klavierstück. Danach gab es einen Austausch darüber, was jeder/jede dabei erlebt hat, seien es Bilder, Erinnerungen, Gefühle.
In einer zweiten Runde hörten wir dieselbe Musik wieder 2x: Beim ersten Mal konnte mitgesummt werden, in der zweiten Runde standen wir alle auf und ließen unseren Körper von der Musik bewegen.
Im Austausch danach zeigte sich eine interessante Veränderung: Bei allen wurde die Musik nun auf neue Weise wahrgenommen.
In einer dritten Runde war die Frage: Welche Form haben die verschiedenen aufeinanderfolgenden Elemente der Musik, und wie können wir diese in einer zeichnerischen Form auf dem Papier (ein Flipchart-Blatt) darstellen? Wer eine Idee dazu hatte, malte diese auf das am Boden liegende Blatt. Nun war die Musik in dieser gezeichneten Form vor uns sichtbar.
Im letzten Schritt „schrieb“ Carola auf der Flipchart die Musik mit symbolischen Zeichen entsprechend ihrer subjektiven Wahrnehmung „mit“, und es war für alle überraschend, wie darin die Struktur der Musik sichtbar ausgedrückt war.
Insgesamt konnten wir zum Schluss feststellen, dass jeder für sich und wir gemeinsam einen Prozess gemacht hatten: die Wahrnehmung der immer gleichen Musik auf verschiedene Weise, zuerst allein über unsere Ohren, dann mit eigener Beteiligung der Stimme und vor allem mit körperlichem Ausdruck. Wir konnten alle feststellen: Die Musik macht etwas mit uns und wir machen etwas mit der Musik – und unser verbaler Austausch über das jeweils Erlebte war eine gegenseitige Bereicherung und hat „mitgespielt“ in dem ganzen Prozess.
Danke, Carola, für dieses ganz besondere Gemeinschaftserlebnis!

So erwuchs aus wiederholtem Hören Erkennen. Aus Eindrücken – mitgeteilt in mehreren Runden mit Redestab, die in den Hörprozess eingeschoben waren – und einfachen Aufzeichnungen entstand Orientierung in den Klängen. Dadurch stellte sich eine Verbindung nicht nur mit dem Wesen der Musik, sondern auch miteinander und mit dem eigenen tieferen Sein ein.
Was also haben achtsames Musikhören und achtsamer Dialog gemeinsam? Und wie können sie sich wechselseitig bereichern und inspirieren?
Was beim Dialog das „Thema“ ist, ist bei Musicosophia die Musik. Beide Ansätze ähneln sich durch die Haltung, mit der zugehört wird, sowie durch die Praxis des Wechsels zwischen Stille, aktivem Zuhören und Austausch.
Im Dialog nehmen Menschen eine Haltung von Respekt und wacher Offenheit den anderen gegenüber ein. Er ist gekennzeichnet durch Langsamkeit und zugewandtes Zuhören. Das alles gilt auch in der von Musicosophia praktizierten Begegnung mit der Musik: „In Verlangsamung und Stille wenden wir uns dem Wesen der Musik zu und nehmen es wahr“, so Carola zu dieser speziellen Zuhörtechnik. Es geht dabei stets um Wahrnehmungen und Erfahrungen, die im Moment gemacht und aus dem eigenen Inneren in die Mitte hin ausgesprochen werden.
Im Ergebnis führen beide Praktiken schließlich zu einer tieferen Art der Beziehung – man könnte hier auch von Resonanz, Kohärenz oder Stimmigkeit (Eingestimmtheit) sprechen – mit dem eigenen Inneren, mit den anderen Teilnehmenden oder dem Gegenüber im Dialog, sowie mit der Musik oder eben dem jeweiligen Thema und seinen verschiedenen Aspekten.
Überdies, so fasst Carola ihre Eindrücke zusammen, ist sowohl das achtsame Musikhören als auch der achtsame Dialog „besonders geeignet, einen Gemeinschaftsprozess erfahrbar zu machen. Was ich als Vertiefung beider Ansätze beobachtet habe: Das Gemeinschaftserlebnis wird als besonders verbindend erlebt. Auch die Verbindung mit dem Wesen der Musik gewinnt an Tiefe. Hier wie da wirken die Regeln des achtsamen Dialogs reinigend, verdeutlichend und zuweilen wie ein ‚Vergrößerungsglas‘.“ So kann man denn beide Praktiken treffend als „Geschwister im Geiste“ bezeichnen.
„Im geistigen Leben gibt es immer wieder unerwartete Beziehungen, bei denen unterschiedliche Ansätze sich gegenseitig beleuchten und sogar verstärken können“ (aus dem Vorspann zum Artikel von Rüdiger Sünner: “Anthroposophie als Sprachspiel und Lebensform bei Ludwig Wittgenstein, info3).
Vielen Dank an alle, die diese „Werkstatt“ mitgetragen haben!
